Seit 60 Jahren akzeptiert die katholische Kirche andere Religionen
Die Erklärung « Nostra Aetate » des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1962 bis 1965 war ein bedeutender Schritt : Die römisch-katholische Kirche relativierte ihren exklusiven Heilsanspruch und öffnete sich für den Respekt gegenüber anderen Religionen sowie dem Antisemitismus und veränderte ihre Einstellung zu Judentum und Islam. Es war der Beginn des interreligiösen Dialogs.
Als am 28. Oktober 1965 die Konzilsväter « Nostra Aetate » mit 2’221 gegen 88 Stimmen angenommen hatten, kam dies einer Revolution gleich : Offiziell hatte es bis anhin ausserhalb der römisch-katholischen Kirche kein Heil gegeben. Nun wollte die römisch-katholische Kirche auf die anderen Religionen blicken, « um ihnen zu sagen, dass die katholische Religion dem mit Hochachtung begegnet, was sie an Wahrem und Heiligem bei ihnen findet », wie es Papst Paul VI. sagte. Dies bedeutete vor allem einen Umbruch im Verhältnis zu den Jüdinnen und Juden. Die Kirche hatte diese seit ihrem Bestehen als Gottesmörder verurteilt und sich zur Erbin der Berufung Israels erklärt. Am Karfreitag wurde für die « perfiden Juden » gebetet. Papst Johannes XXlll. wollte eine Erklärung zu Kirche und Judentum ; er kam aber nicht weit und verstarb 1963.
Manche Kardinäle verhandelten weiter heimlich mit jüdischen und islamischen Autoritäten. Erzkonservative Kardinäle verbreiteten judenfeindliche Pamphlete. In der arabischen Welt galt ein « Judendekret » als Parteinahme für Israel und gegen die Palästinenser. Einige orthodoxe und orientalische Kirchen äusserten Vorbehalte – die Erklärung verschwand. Dann reiste der neue Papst Paul VI. im Jahr 1964 nach Israel. Ein Paukenschlag für die Hardliner. Papst Paul VI. weitete die Erklärung auf Wunsch der Konzilsväter aus dem Nahen Osten auf den Islam, aber auch die anderen Religionen aus, « Nostra Aetate » wurde angenommen.
Gemeinsame Basis mit dem Judentum
Zum Islam heisst es im Text unter Punkt 3 : « Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. » Dagegen verdeutlicht Punkt 4 die Verwandtschaft von Juden- und Christentum : « Bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des Bandes, wodurch das Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist. » Man betonte, dass Jesus als Jude geboren wurde und auch die Apostel, « die Grundfesten und Säulen der Kirche, sowie die meisten jener ersten Jünger, die das Evangelium Christi der Welt verkündet haben». Weiter sind die Jüdinnen und Juden nach dem Zeugnis der Apostel immer noch von Gott geliebt. Die Kirche sei zwar das neue Volk Gottes, « trotzdem darf man die Juden nicht als von Gott verworfen oder verflucht darstellen». Weiter wird betont, dass im Religionsunterricht und in den Predigten kein solches Gedankengut verbreitet werden dürfe.
Danach wendet sich die Kirche vom Antijudaismus ab : «Obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben (Punkt 13), kann man dennoch die Ereignisse seines Leidens weder allen damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden zur Last legen. » Dieser Satz galt als revolutionär, ist aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Warum sollten alle Jüdinnen und Juden für etwas verantwortlich sein, das vor fast 2’000 Jahren geschah ? Auch die Verurteilung des Antisemitismus ist verschämt : Die Kirche beklagt aus Liebe « alle Hassausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgendjemandem gegen die Juden gerichtet haben. » Immerhin ein Anfang.
Jesus, der Jude
« Es hat mich oft geärgert, hat mich Tränen genug gekostet, wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, dass unser Herr ja selbst ein Jude war », schreibt Gotthold Ephraim Lessing in seinem Drama « Nathan der Weise ». In « Nostra Aetate » hat die Kirche die Tatsache, dass Jesus, Maria und die Jüngerinnen und Jünger jüdischer Herkunft waren, endlich anerkannt. Christinnen und Christen mussten jetzt ganz konkret begreifen, dass der Gott Jesu in der hebräischen Bibel spricht und dass das Neue Testament aus jüdisch-messianischen Schriften besteht, die Jesu Leben und Tod im Glauben an den Gott Israels sehen.
1974 wurden daher « Vatikanische Richtlinien und Hinweise für die Durchführung der Konzilserklärung ‹ nostra aetate › » publiziert. Hier wurde betont, dass man die Bibel gerecht auslegen müsse, besonders dort, wo « scheinbar das jüdische Volk » in ein « schlechtes Licht » gesetzt werde. Man müsse den Sinn des Textes herausarbeiten. So müsse man « die Juden » bei Johannes besser mit « die Führer der Juden » oder « die Feinde Jesu » übersetzen, « wobei der Anschein zu vermeiden ist, als sei hier das jüdische Volk als solches gemeint ». Die jüdische Identität Jesu solle betont werden. Gerade bei den Bibeltexten der Karwoche müssten entsprechende Erklärungen verbindlich erfolgen. Doch nach mehr als 50 Jahren sind die « Richtlinien » selbst bei Liturgiefachleuten kaum bekannt, sie haben sich in der Schweiz nicht durchgesetzt.
Dies gilt ebenfalls für den « Tag des Judentums ». Die Jüdisch / Römisch-katholische Gesprächskommission der Schweizerischen Bischofskonferenz und des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes schuf 2012 eine weitere Handreichung zu diesem Tag. Er soll bewusst machen, wie tief der christliche Glaube mit dem Judentum verbunden ist. Auf der Homepage des Liturgischen Instituts der deutschsprachigen Schweiz werden vor dem zweiten Fastensonntag jedes Jahr Fürbitten für diesen Gottesdienst formuliert. Dennoch geht dieser Tag meist vergessen.
Schuldbekenntnis und Annäherung
« Nostra Aetate » ermutigte Christinnen und Christen, die Hebräische Bibel als Basis des jüdischen wie christlichen Glaubens zu studieren. Da die Beziehung zum Judentum alle Bereiche des Christseins prägt, wurden Gesprächsgruppen und Kommissionen der jüdisch-christlichen Zusammenarbeit eingesetzt. In der Schweiz wurde die christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft bereits 1946 gegründet. Religionsbücher wurden überarbeitet, in Hebräischwochen studieren seit fast 50 Jahren jüdische und christliche Fachleute hebräische Urtexte.
1975 kam es zum Eklat. Die Karfreitagsfürbitte hatte bis anhin geheissen : « Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat : Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen … ». 2008 erlaubte Papst Benedikt die tridentinische Messe wieder und schrieb dazu eine Fürbitte : « Lasst uns auch beten für die Juden, dass Gott, unser Herr, ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus als den Heiland aller Menschen erkennen. Allmächtiger Gott, gewähre gnädig, dass ganz Israel gerettet werde, wenn alle Völker in deine Kirche eintreten. » Damit befürchteten viele die Rückkehr zur Judenmission. Dem widersprach zum Glück entschieden der zuständige Präsident der vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum, Kardinal Walter Kasper.
1994 regte Papst Johannes Paul ll. ein Schuldbekenntnis der Kirche an, erhielt jedoch viel Gegenwind : Man könne Sünden früherer Gläubiger nicht bereuen, dazu befürchtete man Missverständnisse oder dass der Papst Christen in islamischen Ländern angreifbar machen könnte. Im Heiligen Jahr 2000 entschuldigte sich der Papst dann im Namen der Kirche für deren Versagen gegen Frieden, Toleranz, Menschenrechte, Ökumene und die Würde der Frau. Sehr klar benannte er, der die Verfolgung der Nazizeit hautnah erlebt hatte, auch die Schuld der Kirche gegenüber Jüdinnen und Juden : « Wir sind zutiefst betrübt über das Verhalten aller, die im Laufe der Geschichte deine Söhne und Töchter leiden liessen. Wir bitten um Verzeihung und wollen uns dafür einsetzen, dass echte Brüderlichkeit herrsche mit dem Volk des Bundes. » Er legte den Text im Herbst 2000 auch in die Mauer in Jerusalem.
Der 7. Oktober 2023 und die Folgen
Das Massaker vom 7. Oktober 2023 und der Krieg haben zu Bruchstellen im jüdisch-christlichen Dialog geführt, im Gegensatz zum christlich-muslimischen, der gerade Fortschritte machte. So suchte Papst Franziskus in seinem Brief zum ersten Jahrestag an die Katholikinnen und Katholiken im Nahen Osten nach dem « wahren Feind » und fand ihn im « Mörder von Anfang an », im « Vater der Lüge » (Joh 8,44). Er zitierte damit eine der dunkelsten Stellen im Neuen Testament, die in der Geschichte häufig antijudaistisch ausgelegt wurde und in der Vergangenheit zur Rechtfertigung von Judenfeindschaft missbraucht wurde, unter anderem von Hitler. Das Zitat führte innerkirchlich zu Kritik. Die Hamas kommt dort übrigens nicht vor. Die Kirche engagiert sich auch nicht energisch gegen den seitdem massiv gewachsenen Judenhass. « Papst Franziskus sei keine Schutzmacht für bedrohte Juden », sagte etwa der katholische Theologie-Professor und Fachmann Gregor Maria Hoff.
Der neue Papst Leo XIV. versprach aber in einem offiziellen Schreiben an den Direktor für interreligiöse Angelegenheiten des American Jewish Congress, Rabbi Noam Marans, den Dialog mit den Jüdinnen und Juden im Geiste der Erklärung « Nostra Aetate » weiter zu stärken. Dies ist gerade zum 60. Geburtstag der Konzilserklärung eine wichtige Absicht.
Christiane Faschon, 06.10.2025






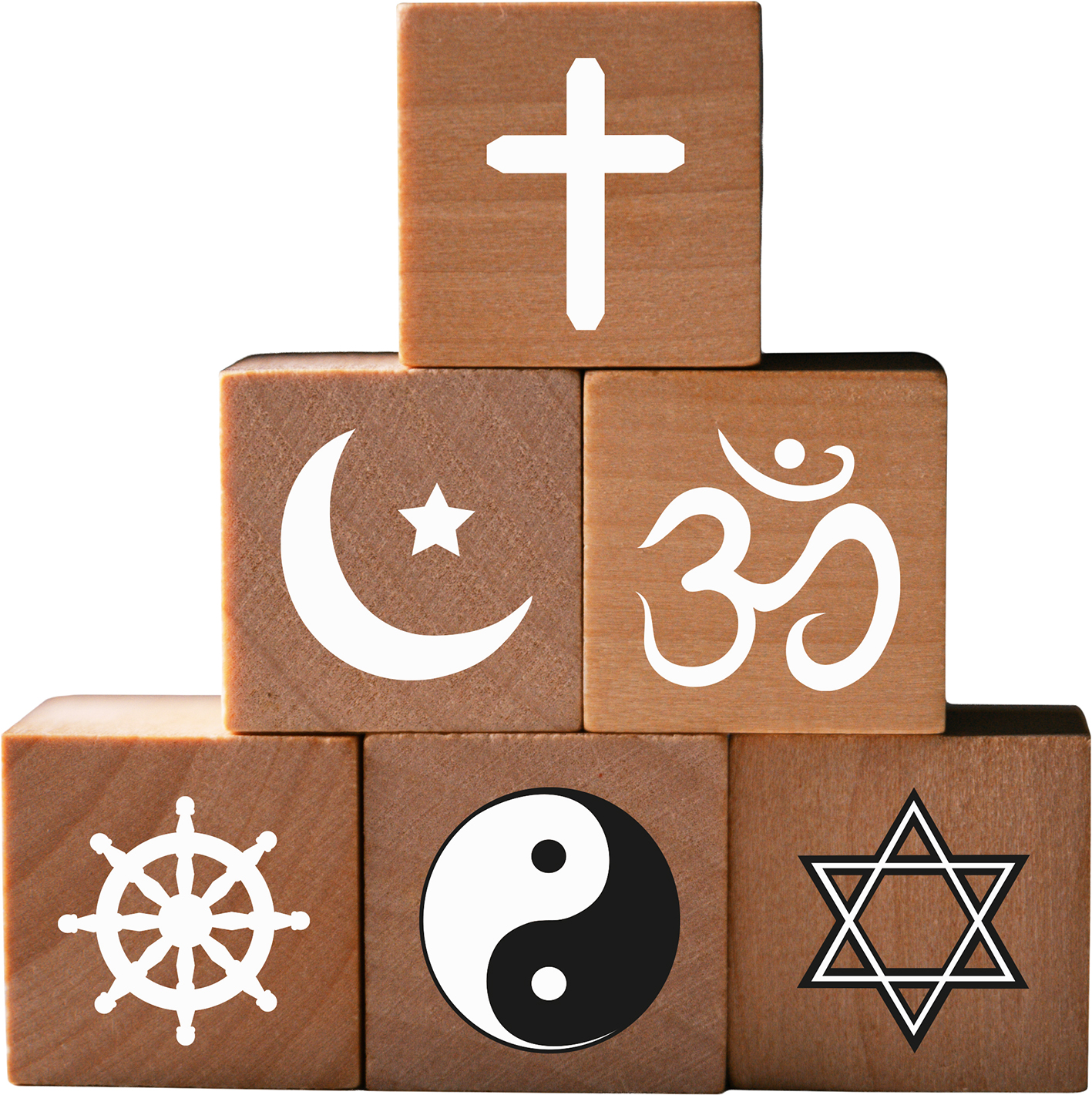





Kommentare